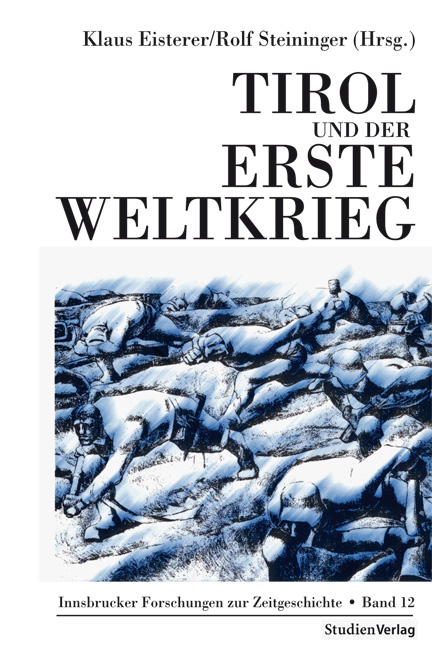Alte Tirolensien neu gelesen (Teil 49)
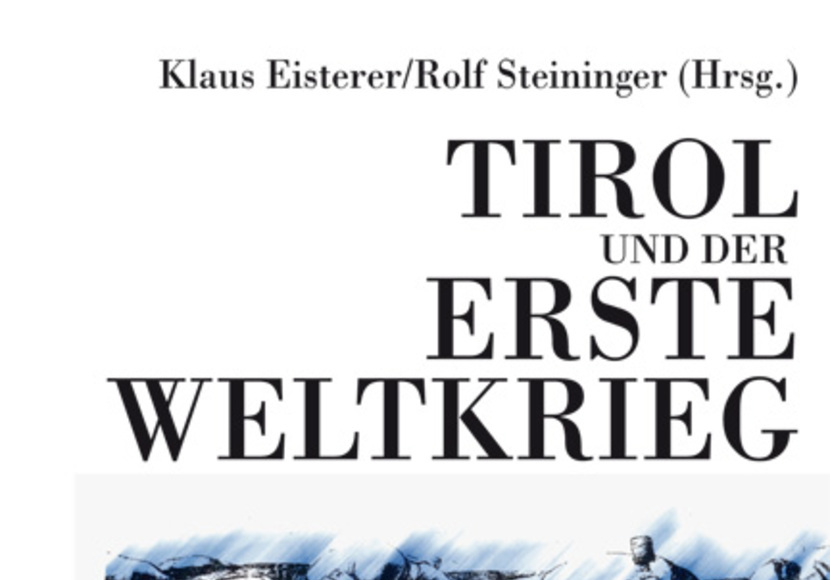
Der Krieg in Tirol: Front, Hunger und Evakuierung
Wolfgang Etschmann beschreibt in seinem Aufsatz die Kampfhandlungen an der Südfront zwischen 1915 und 1918 und zeigt auf, wie Tirol als Kriegsschauplatz strategisch genutzt wurde. Besonders deutlich wird hier die Bedeutung der Dolomitenfront, die Helmut Alexander in seinem Beitrag zum „Tiroler“ Film ebenfalls aufgreift. Er analysiert, wie der Krieg in der filmischen Darstellung verarbeitet wurde und wie sich dadurch ein bestimmtes Bild von Tirol als Verteidigungsbollwerk etabliert hat.
Die kriegerische Auseinandersetzung hatte aber keinesfalls nur militärische, sondern auch gravierende gesellschaftliche Nachwehen. Gerhard Prassnigger widmet sich dem Thema Hunger in Tirol und zeigt auf, wie die Kriegswirtschaft und die Isolation des Gebiets zu einer massiven Versorgungskrise führten. Hermann J. W. Kuprian beleuchtet ferner das Schicksal von Flüchtlingen, Evakuierten und der staatlichen Fürsorge, ein wiederholt vernachlässigter Abschnitt der Tiroler Geschichte im Ersten Weltkrieg.
Mythos und Realität: Die Rolle der Stand- und Kaiserjäger
Ein weiteres bedeutsames Thema des zu rezensierendes Bandes ist die Militarisierung und Verklärung des Krieges. Christoph von Hartungen untersucht in seiner Abhandlung die Tiroler und Vorarlberger Standschützen und stellt die Frage nach der geschichtlichen Wahrheit hinter der Heldenlegende. Klaus Eisterer geht in seinem Aufsatz noch weiter und zeigt am Beispiel der Kaiserjäger und der Kaiserjägertradition, wie der „Heldentod“ nachträglich glorifiziert wurde.
Gesellschaftliche und kulturelle Perspektiven
Hans Heiss rückt die Stimmung in der Bevölkerung in den Fokus. Er untersucht die Volksmeinung und Volkserfahrung in Tirol während des Krieges und veranschaulicht, dass der Krieg nicht bloß eine militärische, sondern auch eine tiefgreifende gesellschaftliche Krise auslöste. Elisabeth Dietrich behandelt in ihrem Artikel die Folgen von Seuchen und Volkskrankheiten und zeigt, wie das Gesundheitswesen in Tirol unter den Bedingungen des Krieges zusammenbrach.
Johann Holzner widmet sich der Tiroler Literatur und dem Großen Krieg und zeigt auf, wie der Erste Weltkrieg in literarischen Werken verarbeitet wurde. Auch hier wird deutlich, dass der Krieg nicht nur ein politisches und militärisches Desaster war, sondern auch eine tiefe Wunde in das kulturelle Erinnerungsvermögen Tirols geschlagen hat.
Schlussbetrachtung: Weiße Flecken der Geschichtsschreibung
Richard Schober fasst in seinem Beitrag die offenen Fragen zusammen und weist auf die weißen Flecken in der Historiografie hin. Auch wenn der Erste Weltkrieg in der Forschung inzwischen intensiv beleuchtet wird, gibt es immer noch Aspekte, die weiterer Untersuchungen bedürfen.
Fazit: Ein unverzichtbares Werk zur Tiroler Zeitgeschichte
Das Buch „Tirol und der Erste Weltkrieg“ ist eine faszinierende Sammlung von Aufsätzen, die unterschiedliche Sichtweisen auf eine der prägendsten Phasen der Tiroler Geschichte werfen. Besonders wertvoll ist die Verknüpfung von militärischer, sozialer und kultureller Untersuchung, die dem Leser ein ganzheitliches Einfühlungsvermögen der Begebenheiten vermittelt. Mit 342 Seiten und vielen Bilddokumenten bietet das Werk keinesfalls nur eine kundige wissenschaftliche Auseinandersetzung, sondern auch eine visuelle Illustration der vergangenen Ereignisse. Es ist ein unverzichtbarer Lesestoff für alle, die sich mit der Tiroler Geschichte zwischen 1914 und 1918 befassen.
von Andreas Raffeiner
————————-
Klaus Eisterer/Rolf Steininger (Hrsg.), Tirol und der Erste Weltkrieg (Innsbrucker Forschungen zur Zeitgeschichte, Bd. 12), Innsbruck 1995 (Neuauflage 2011).