Bei dem Finale war die ORF-Moderatorin gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Florian Gschaider eine Klasse für sich. Sowohl für den vorgegebenen Salsa-Tanz als auch für ihren frei gewählten Tango erhielten sie von der Jury die Höchstnote von 40 Punkten. Selbst Gnadenlos-Juror Balazs Ekker vergab – für ihn völlig untypisch – gleich zwei Mal zehn Punkte. „Es ist das beste Paar. Der beste Promi und der beste Profi“, lobte Ekker. Auch Co-Juror Hannes Nedbal war begeistert: „Das war Tango auf höchstem Niveau“.
Besonders angetan waren die Juroren davon, dass Scheitz bei ihrer Finaleinlage rein aufs Tanzen gesetzt und einfach einen „wunderschönen Walzer“ geboten hat. „Das erste Mal in dieser Sendung“, unterstrich Nedbal. Ihren Sieg wollte das Tanzpaar erstmals gebührend feiern. „Ich werde jetzt einmal etwas Trinken gehen. Wochenlang habe ich nun fast gar keinen Alkohol getrunken“, sagte Scheitz.
Thomas Morgenstern kann sich über den zweiten Platz mehr als freuen. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern hatte der Ex-Skispringer weder eine große Ahnung vom Tanzen noch von Musik generell. Auch im Finale trug ihn vor allem die Gunst des Publikums weiter. „Es schaut einfach aus, aber wenn man es selten macht, steht man schnell an“, sagte der ehemalige Leistungssportler nach seinem Auftritt. Auch die Jury zollte Respekt: „Es war wirklich eine beachtliche Steigerung.“ Als Sondereinlage wählte Morgenstern einen Apres-Ski-Mix aus „So a schener Tag“ und „Tutti Frutti“.
Für den heimlichen Favoriten der Show, den Russkaja-Sänger Goergij Makazaria, war letztlich nur der dritte Platz drinnen. Doch auch in der Finalshow zeigte er, dass ein imposanter Körperbau und filigranes Tanzen kein Widerspruch sein müssen. Mit Partnerin Maria Santner fetzte er bei einer Schnell-Salsa geradezu über das ORF-Parkett. „Das war fußeln auf höherem Niveau, ganz besonders reizend“, lobte Juror Thomas Schäfer-Elmayer.
Doch nicht nur das Finale, sondern auch ganz generell war die zehnte Staffel von „Dancing Stars“ den Profi-Bewertern zufolge eine positive Überraschung. Die Leistung der Teilnehmer war Ekker zufolge gar die „stärkste aller Zeiten“.
Bleibt zu abzuwarten, welche Promis der ORF für eine etwaige elfte Ausgabe gewinnen kann. Inzwischen gab es jedenfalls derartig viele Ex-Kandidaten, dass für sie am Freitag ein eigenes Studio bereitgestellt werden musste. Gewonnen haben unter anderen: Marika Lichter (2005), Manuel Ortega (2006), Klaus Eberhartinger (2007), Dorian Steidl (2008), Claudia Reiterer (2009), Astrid Wirtenberger (2011), Petra Frey (2012), Rainer Schönfelder (2013) und zuletzt Roxanne Rapp (2014).
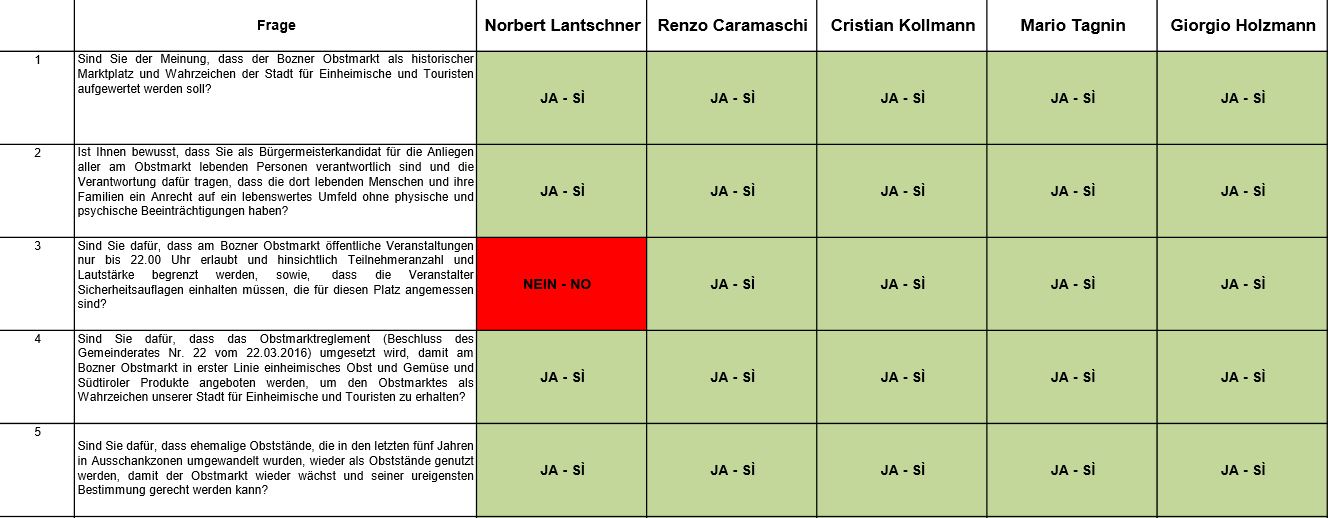
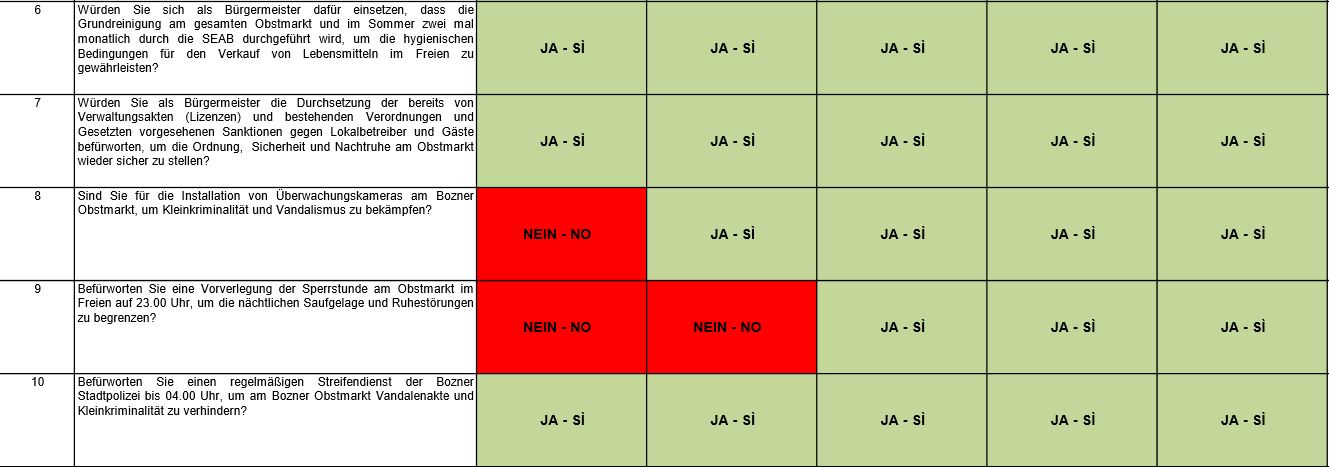
UT24: Herr Neubauer, LH Arno Kompatscher hat in diesen Tagen FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache heftig dafür kritisiert, weil er sich in einem Interview für eine Wiedervereinigung Tirols ausgesprochen hat. Was sagen Sie dazu?
Ich verstehe die Aufregung insgesamt nicht. Die Freiheitliche Partei Österreichs ist nämlich seit ihrer Gründung immer für die Wiedervereinigung Tirols eingetreten. D.h., dass was unser Bundesparteiobmann Strache hier in einem Interview gefordert hat, ist eigentlich eine 60 Jahre alte Forderung unserer Partei. Sozusagen ist es nichts wirklich Neues. Außerdem ist es auch ein Punkt, den beispielsweise die Südtiroler Volkspartei selbst seit Jahren in ihrem Parteistatut verankert hat.
UT24: Auch in den sozialen Netzwerken hat die Forderung für viel Furore gesorgt. Viele Südtiroler begrüßen den Vorstoß von Strache, es gibt jedoch auch kritische anti-österreichische Stimmen. Haben Sie diese Diskussion beobachtet?
Ja, auch ich habe mir zuletzt die Mühe gemacht, einige Reaktionen mitzuverfolgen. Da gab es teilweise sogar Aussagen, wonach eine Selbstbestimmung Südtirols dem EU-Recht und der italienischen Verfassung widersprechen würde. Aber genau an solchen Wortmeldungen sieht man eindeutig, welche Versäumnisse gerade die SVP bei der Bevölkerung Südtirols in den letzten 10 Jahren aufkommen hat lassen. Wenn die Leute nicht einmal wissen, dass das Selbstbestimmungsrecht selbstverständlich in der italienischen Verfassung verankert ist und es sich dabei um ein Völkerrecht handelt, was mit dem EU-Recht überhaupt nichts zu tun hat, dann macht das vor allem eines sichtbar: eine grundlegende Aufklärung über diese Fragen wäre längst überfällig. Denn es gab nicht nur eine Bemerkung in diese Richtung, sondern sehr viele sogar.
UT24: Der Südtirol-Unterausschuss des österreichischen Nationalrates kommt ja in der nächsten Woche nach Bozen. Werden Sie diese Gelegenheit nutzen, um Kompatscher mit seinen Äußerungen zu konfrontieren?
Selbstverständlich. Wir gehen immer den Weg des Dialoges, sowohl mit politischen Mitbewerbern, als auch mit der SVP. Was uns aber im Rahmen dieses Besuchs besonders beschäftigen wird, ist der zurzeit stattfindende Südtirol-Konvent. Man hat uns hierzu bereits vor einem Dreivietel Jahr versprochen, uns permanent über die Entwicklung des Konventes zu informieren. Wir haben jedoch bis heute keine einzige Information offizieller Natur erhalten, was bei diesem Konvent herausgekommen ist. Das hat uns Kompatscher und seine Delegation in Wien damals jedoch dezidiert zugesagt. Das war auch der Grund, warum wir jetzt gefordert haben, dass bei dem Besuch des Unterausschusses in Südtirol die nunmehr feststehenden 33 Personen aus dem „Konvent der 33“ zu dieser Tagung am kommenden Dienstag eingeladen werden sollen. Daher bin ich bereits gespannt, was in diesem Hinblick nun passiert.
UT24 Wie stellt sich die FPÖ die Ausübung des Selbstbestimmungsrechtes der Südtiroler konkret vor?
Wir haben immer gesagt, dass wir diesen Wunsch bekräften und unterstützen. Die Forderung selbst muss allerdings von Südtiroler Seite aus kommen. Das gilt auch für die Entscheidung des richtigen Zeitpunkts einer solchen Abstimmung im Sinne des Selbstbestimmungsrechtes. Bereits am nächsten Wochenende wird eine prominente Delegation unserer Partei an der sehr interessanten „iatz!“-Veranstaltung in Bruneck teilnehmen. Diese Entwicklung dort werden wir sehr genau beobachten, da das Südtiroler Volk den Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung dort erheben will.
UT24: Die Südtiroler Volkspartei wird in ihrer morgigen Landesversammlung den Punkt der Selbstbestimmung in ihrem Parteiprogramm genauestens diskutieren. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung vonseiten der Regierungspartei?
Das ist ein gutes Zeichen dafür, dass selbst in der sonst so stark blockierenden SVP auf einmal Stimmen laut geworden sein müssen, dass man sich dem nicht mehr verschließen kann. Also warum wirft man dann unserem Bundesparteiobmann Strache Populismus vor, wenn er hier einen Vorstoß macht, um der SVP die Entscheidung beim Parteitag zu erleichtern? Die SVP hat wohl gemerkt, dass sie eine Art Duftnote in diese Richtung in ihrem Programm verankern muss, wenn sie nicht weiterhin am Volk vorbei regieren will. Grundsätzlich ist jedoch jede Initiative in diese Richtung, ganz egal von welcher Partei, zu unterstützen.
Die wirkliche Verlängerung der Asphaltpiste am Bozner Flugplatz um über einen halben Kilometer rechnee die Landesregierung mittlerweile bis auf 168 und sogar bis auf 30 Meter klein. In Wirklichkeit betrage die Verlängerung der Asphaltpiste über einen halben Kilometer!“
„Die von den Flughafenbefürwortern öffentlich mitgeteilte Pistenverlängerung sinkt also proportional zum zeitlichen Abstand von der Volksbefragung – je kürzer die Zeit bis zur Volksbefragung desto kürzer auch die Pistenverlängerung“, so Pöder.
Viele Frauen wollen nach der Geburt so bald als möglich wieder in ihren Beruf zurückkehren und nutzen dafür das Angebot ihre Kinder während der Arbeitszeit in eine Kindertagesstätte zu geben, so die Landtagsabgeordente Myriam Atz Tammerle.
Doch für jene Frauen, die lieber bei ihren Kindern bleiben möchten, gebe es keine Möglichkeit. Sie erhalten für die Erziehungszeit ihrer Kinder weder einen Lohn, noch sind sie rentenversichert. In mehreren Nachbarstaaten gebe es bereits das Modell des „Rentensplittings“ – der Rentenaufteilung unter Ehe- und Lebenspartnern.
Rentenbeitrag auf berufstätigen Partner übertragen
Dabei werde ein Teil vom Rentenbeitrag des berufstätigen Partners auf den anderen übertragen. Dadurch könnte zumindest ein Ausgleich beim Rentenbeitrag erreicht werden und die Entscheidung der Familiengründung wird nicht zur Lohn- und Rentenfalle. Die Mütter könnten selbst bestimmen, ob sie wieder arbeiten gehen oder bei ihren Kindern bleiben möchten. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich sei dies bereits möglich.
„Deshalb fordert die Frauengruppe der Süd-Tiroler Freiheit, dass endlich die gesetzlichen Voraussetzungen auch für unsere Mütter in Süd-Tirol geschaffen werden und wünscht allen Müttern einen schönen Muttertag im Kreise ihrer Lieben.“, so Atz Tammerle abschließend.
Der Unfall ereignete sich am heutigen frühen Nachmittag in Tux.
Eine deutsche Urlauberfamilie war am frühen Nachmittag zum Wandern in ein noch teils schneebedecktes Gelände aufgebrochen. Dort verlor das 9-jährige Mädchen aus noch ungeklärten Gründen plötzlich den Halt und stürzte 200 Meter in die Tiefe.
Im Einsatz stand die Bergrettung Tux, ein Mitarbeiter der Gletscherbahnen, sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 1. Das Kind wurde in die Klinik von Innsbruck gebracht.
Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft und koordiniert von Förster Alex Zambelli Pavà wurden mehrere Zeisige, Gimpel, Stieglitze, Girlitze und Fichtenkreuzschnäbel, sowie eine Goldammer und ein Grünfink beschlagnahmt.
Das seien so viele wie noch nie in der Geschichte des Landesamtes für Jagd und Fischerei zuvor, berichtet der geschäftsführende Direktor Luigi Spagnolli.
In Beschlag genommen wurden zudem Netzklappfallen und Käfige.
Vögel standen unter Schutz
Sieben der laut Jagdgesetz unter strengstem Schutz stehenden Vögel wurden in das Vogelschutzzentrum in Bozen gebracht und werden wahrscheinlich im Herbst in die Freiheit entlassen; die übrigen 42 wurden an Ort und Stelle befreit.
Das Amt für Jagd und Fischerei dankt den Beamten der Finanzwache und der Carabinieri für die tatkräftige Zusammenarbeit.
Zusätzlich soll Timperio in seinem Posting Zweifel geäußert haben, ob Österreich die Südtiroler überhaupt wolle.
Originalwortlaut:
Ma se l’Italia vi fa così schifo perchè non ve ne andate in Austria. Per il biglietto facciamo una colletta e ve lo paghiamo noi italiani. Solo andata naturalmente. Ma forse non vi vogliono neanche gli austriaci.
PD – eine nationalistische Partei?
Derart offene Anfeindungen hat es während des gesamten Wahlkampfes bisher noch nie gegeben. Vor allem, dass ein Mitglied einer Partei, die sich selbst als demokratische Partei bezeichnet, so offen Hetze betreibt ist äußerst bedenklich.
So schreiben der Bürgermeisterkandidat der STF, Cristian Kollmann und Listenführer Alexander Wurzer in einer gemeinsamen Presseaussendung.
Auf der anderen Seite müsse man laut der STF jedoch froh sein, dass sich der PD endlich selbst als das entlarvt habe, was er effektiv sei:
Eine nationalistische Partei, ohne jegliches Verständnis für Minderheiten, so der Vorwurf der STF.
Wie reagiert die SVP?
Gespannt dürfe man nun sein, wie die Südtiroler Volkspartei über derartige menschenverachtende Aussagen seines Koalitionspartners reagiere.
Es sei klar, in Wahlkampfzeiten werde mit härteren Bandagen gekämpft. Doch der Angriff auf eine gesamte Volksgruppe stelle immer noch ein Tabu dar, so die STF Bozen.
Wir rufen alle Bozner auf, den PD nicht zu wählen! Eine Partei mit solchen Politikern ist nicht tragbar und für ein friedliches Zusammenleben äußerst hinderlich.
so schließen Kollmann und Wurzer.
SVP-Leute unterschrieben für Wiedervereinigung Tirols
Kurz nach Kriegsende mobilisierte nicht nur der gesamte Südtiroler Klerus seine Stimmen, um die Rückkehr zum Mutterland Österreich einzufordern, sondern auch die einzige damals genehmigte Partei der deutschen und ladinischen Minderheit, nämlich die Südtiroler Volkspartei.
Alle Ortsobmänner unterzeichneten die vom zuständigen SVP-Bezirk vorbereitete Petition im Namen aller Mitglieder. Dem SHB liegen Kopien der Originale aus dem August 1945 vor mit den Namen der Ortsobmänner und dem Text der je nach Bezirk im Grunde ähnlich lautenden Petition. So sprachen sich damals zum Beispiel die Orstobmänner des Burggrafenamtes explizit dafür aus, dass das alte Herz- und Kernland Tirols, in dem seine Stammburg steht, Meran, Burggrafenamt und Passeier (…) an Österreich angeschlossen werden wolle (…).
Alle Bezirke waren dafür
Im Kontext brachten alle Bezirke die eindringliche Bitte der Südtiroler Bevölkerung der zuständigen Dörfer und Bezirke zum Ausdruck, dass das Unrecht von 1919, der Annexion durch Italien, wieder gutgemacht wird und Südtirol mit Nord- und Osttirol wieder vereint werde. Der Pustertaler Bezirk erwähnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich die unnatürliche und wirtschaftshemmende Zerreißung des Pustertales durch die Unrechtgrenze. Eine interessante Parallele, wie sie auch heute bezüglich der Grenzzaunproblematik von Landespolitikern vorgebracht wird, so Roland Lang in einer Aussendung.
Man unterstrichauch die Möglichkeit, dass wenn von Seiten der Alliierten Zweifel an der Aufrichtigkeit der Petition und des Volkswillens bestünde, man dies durch eine freie Volksabstimmung überprüfen lassen könne. Der Bezirk Sterzing bekundet, dass man schon immer mit dem nördlichen Teil des Wipptals jenseits des Brenners zu einer Einheit verbunden gewesen sei und dass dies durch die obig erwähnten demokratischen Schritte wieder richtiggestellt werden soll.
Insgesamt unterschrieben 7 Bezirksobmänner und 136 Orstobmänner die Petitionen, die eindeutig den Willen des Südtiroler Volkes von politischer Seite bekunden sollten – für die Unrechtsbeseitigung und die Selbstbestimmung, so Lang abschließend.
SVP: „Geburtenstation wird erhalten“
„Wir haben heuer in Sterzing eindeutig mehr Geburten als in den letzten Jahren, so dass die geforderte Zahl von 500 mit großer Wahrscheinlichkeit klar überschritten wird.“, so Polig. Somit brauche es auch keine Ausnahmegenehmigung aus Rom.
Die Anwesenheit der vorgeschriebenen Fachkräfte müsse allerdings, gleich wie in allen anderen Geburtenstationen, eingehalten werden. Man sei also in in der selben Situation, wie z.B. Brixen oder Bruneck, teilt Karl Polig mit.
Damit stehe laut dem SVP-Bezirksobmann einem Erhalt nichts mehr im Wege.
Zusicherung von LR Stocker
Landesrätin Martha Stocker habe ebenso die Bereitschaft zur Anstellung der nötigen Fachärzte zugesichert. Angesichts des allgemeinen Fachärztemangels werde die Personalsuche für den Sanitätsbetrieb sicher eine Herausforderung sein.
„Für unseren Bezirk ist der Erhalt einer so wichtigen Struktur von oberster Priorität.“, schließt Polig seine Aussendung.
Tiroler Fans pilgerten nach Hockenheim
Die Böhsen Onkelz haben auch in Tirol sehr viele begeisterte Fans.
Alleine in den beiden vergangenen Jahren pilgerten zahlreiche Anhänger der Kult-Rocker aus allen Tiroler Landesteilen zum Hockenheimring nach Baden-Württemberg (UT24 berichtete).
Das Warten hat ein Ende
Nach einer langen Wartezeit gab die Band gestern die langersehten Termine ihre anstehenden Europa-Tournee in der letzten Jahreshälfte bekannt.
Der Kartenvorverkauf startet in Kürze, weshalb sich die Tiroler Fans bereits auf einen regelrechten „Kampf“ um die begehrten Konzertkarten für München, Wien oder Zürich einstellen dürfen. Die Band ist nämlich ebenfalls für schnell ausverkaufte Konzerte in nur wenigen Minuten bekannt.
Nähere Details zum genauen Ablauf des Vorverkaufs findet ihr hier >>>
Anbei alle Tourdaten der Onkelz im Überblick:
21.11.2016 Frankfurt / Festhalle
22.11.2016 Frankfurt / Festhalle
24.11.2016 Dortmund / Westfalenhalle
25.11.2016 Dortmund / Westfalenhalle
27.11.2016 Stuttgart / Schleyer-Halle
28.11.2016 Stuttgart / Schleyer-Halle
01.12.2016 Wien / Wiener Stadthalle
04.12.2016 Zürich / Hallenstadion
06.12.2016 Hannover / TUI Arena
07.12.2016 Hannover / TUI Arena
09.12.2016 Leipzig / Messehalle 1
10.12.2016 Leipzig / Messehalle1
12.12.2016 Hamburg / Barclaycard Arena
13.12.2016 Hamburg / Barclaycard Arena
16.12.2016 Berlin / Mercedes-Benz Arena
17.12.2016 Berlin / Mercedes-Benz Arena
19.12.2016 München / Olympiahalle
20.12.2016 München / Olympiahalle
22.12.2016 Frankfurt /Festhalle
Auch heuer wurden wieder an 154 Ständen landesweit Primeln verteilt. „Mit 46.131,41.- Euro wurde dabei wieder ein beachtlicher Erlös für die Krebsforschung gesammelt“, so Gebhard. „In den vergangenen 16 Jahren konnten wir auf diese Weise 476.313,58.- Euro sammeln!“
Gebhard dankte in diesem Zusammenhang besonders allen Helferinnen an den Ständen und vor allem auch den Gärtnereien, die diese Aktion mit unterstützt haben.
Spende an Krebshilfe
Der gesamte Erlös in der stolzen Höhe von 46.131,41.- Euro geht an die Südtiroler Krebshilfevereinigung, welche damit die Arbeit der Südtiroler Mikrobiologin Petra Obexer und ihres Teams am Tiroler Krebsforschungsinstitut unterstützen will.
Obexer dankt der spendenfreudigen Südtiroler Bevölkerung besonders herzlich: „Die seit 16 Jahren andauernde Unterstützung aus der Primelaktion der SVP-Frauen ist ein wertvoller Beitrag für unsere Forschungsarbeit. Wir danken von Herzen allen Spenderinnen und Spendern!“
Laut Medienberichten habe die Landesregierung den Südtiroler Tourismusverbänden- und vereinen eine Neuregelung der Tourismusorganisationen, welche eine Einteilung in 3 Regionale Managementeinheiten (RME) vorsieht, vorgestellt. Der Vorschlag von Seiten der Landesregierung sei grundsätzlich begrüßt worden, so Leitner in einer Aussendung.
Entstanden sei die Überlegung einer Reorganisation der Tourismusstrukturen von der Arbeitsgruppe Tourismus bestehend u.a. aus dem Hoteliers- und Gastwirteverband (HGV), dem Landesverband der Tourismusorganisation in Südtirol (LTS) im Rahmen der Diskussion über die Sicherung der Tourismusfinanzierung im Jahr 2014.
Ziel solle es sein, u.a. die Strukturkosten der Tourismusorganisationen zu prüfen und neue Modelle für eine effizientere Struktur zu entwickeln. Daraufhin wurden eine Projektgruppe mit Vertretern von Tourismusverbänden- und vereinen und eine Steuerungsgruppe gebildet, zitiert der Freiheitliche Abgeordnete aus der Antwort des Landeshauptmannes Kompatscher.
„Keine Tourismusorganisation wie heutige Verbände“
Dabei werden die örtlichen Tourismusvereine neben ihren festgesetzten Aufgaben noch zusätzliche Aufgaben erhalten. Finanziert werden diese Aufgaben mit den 75% der Basis-Ortstaxe, mit Gemeindebeiträgen, Schlüsselbeiträgen, welche zwischen dem Tourismusverein und der RME aufgeteilt werden, Investitionsbeiträgen und Eigenfinanzierung, welche aus dem Mitgliederbeitrag und Zuwendungen besteht. 25% der Basis-Ortstaxe gehen hingegen direkt an die RME.
Auf die Frage Leitners, ob für Südtirol eine einzige Tourismusorganisation errichtet werde, antwortete Kompatscher, dass es sich bei den RME um Verwaltungseinheiten handle, die direkt an die IDM (Innovation, Development und Marketing) Südtirol gebunden seien. Daher stellen die drei RME keine Tourismusorganisation im Sinne der heutigen Verbände dar, so der Landeshauptmann abschließend.
Ein Teil der Schäden sei durch Versicherungen abgedeckt. Nun müsse man eruieren, was davon in die Hagelversicherung falle und was von Bund und Ländern an Unterstützung erbracht werden müsse. Dies soll im Lauf der kommenden Woche geklärt werden, erläuterte der Ressortchef.
Eine Öffnung des Katastrophenfonds sei bereits beschlossen worden. Als Sofortmaßnahme, um die Liquidität der Betriebe zu gewährleisten, wurde eine Stundung der Agrarinvestitionsbetriebe ermöglicht. In vielen Kulturen werde man erst bei der Ernte das Schadensausmaß feststellen können. Wichtig sei „das klare Signal: „Die Politik hilft“, sagte Rupprechter. „Wir werden nicht alles ausgleichen können. Aber klar ist, wir können die Bäuerinnen und Bauern in dieser schwierigen Phase auch nicht allein lassen.“
Im Burgenland liege das Schadensausmaß beim Produktionswert nach bisherigen Betrechnungen 60 bis 70 Mio. Euro, berichtete Landwirtschaftskammerpräsident Franz Stefan Hautzinger: „Der Wertschöpfungsverlust geht bis an die 150 Mio. Euro.“
Von den 14.000 Hektar Weingärten seien etwa 4.000 durch eine Frostschadensversicherung abgedeckt. Im Obstbau hätten bisher nur wenige Betriebe die Versicherung in Anspruch genommen, weil sie erst seit einem Jahr angeboten werde.
Nach Ansicht Hautzingers sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein Gesamtpaket in Richtung umfassendes Risikomanagement zu schnüren, das von der öffentlichen Hand auch unterstützt werde. „Es muss in Richtung einer umfassenden Einkommensabsicherung für die Landwirtschaft gehen“, sagte der Landwirtschaftskammerpräsident. Künftig brauche es ein System, wo die Landwirtschaft bei solchen Katastrophen nicht „Bittsteller“ sei, sondern Anspruch auf Unterstützung habe. Das Geld für eine Unterstützung des Prämienaufkommens sei „gut eingesetzt“.
Beim Wein werde man von einer kleinen Ernte 2016 ausgehen müssen, sagte Weinbaupräsident Johannes Schmuckenschlager. Mit der Rebblüte Ende Mai bis Mitte Juni könne man zum ersten Mal einschätzen, wie hoch der Schaden wirklich sei. Nach der Weinernte im Herbst habe man dann die Zahlen genau auf Papier und werde sehen, wo man unterstützen müsse.
Schmuckenschlager unterstützte die Forderung nach einem umfassenden Risikomanagement in der Landwirtschaft. Dabei müsse man in sensiblen Märkten, etwa bei Milch und in der Fleischproduktion, Systeme andenken, wie es sie in den USA in Form von Produktpreis-Absicherungen gebe. Hier sei ein „Sicherheitsnetz“ notwendig, um die Produktion von Lebensmitteln in Österreich absichern zu können.
Auf dem Gehöft in Ostwestfalen soll das Paar in den vergangenen Jahren mehrere Frauen gequält haben. Zwei Opfer aus Niedersachsen kamen ums Leben. Eine 41-jährige starb am 22. April an den Folgen schwerer Verletzungen in einem Krankenhaus. Bereits im August 2014 war eine 31-Jährige nach Misshandlungen gestorben. Hinweise auf weitere Tote gab es bis Freitag nicht.
Die Polizei sucht nach weiteren Opfern des festgenommenen Paares. Es gebe Hinweise darauf, dass in dem Haus vier bis fünf weitere Frauen gewesen sein könnten und dass weitere Kontakte zu Frauen bestanden, hatte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag gesagt. Laut Polizei sind bisher teilweise nur „Namensfragmente“ der Frauen bekannt.
Laut Staatsanwaltschaft arbeiten sich die Ermittler nun auch in den Zeitraum von 1999 bis 2010 vor. So wurden inzwischen die Wohnorte des Paares der letzten Jahre ermittelt. Der Sprecher wollte diese aus ermittlungstaktischen Gründen nicht nennen. Bekannt ist, dass beide zuvor in Schlangen, 50 Kilometer von Höxter entfernt, gewohnt hatten.
Die Carabinieri verfolgten die Schreie, die in einen Garten führten. Dort soll ein Tunesier mit einer Axt einen weiteren Mann bedroht haben, weil er Geld von ihm forderte.
Als die Ordnungskräfte eingreifen wollte, ergriff der Übeltäter, ein 36-jähriger Tunesier, die Flucht.
Beamten nur knapp verfehlt
Als man den Mann jedoch einholen konnte, bedrohte er die Carabinieri mit der Axt und schmiss diese gegen einen Beamten. Dabei verfehlte er den Ordungshüter nur knapp.
Der Mann wurde daraufhin sofort verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht.
Der Tunesier soll demnächst ausgewiesen werden, da er bereits vorbestraft sein soll.
Wie Faymann am Freitag mitteilte, sollen zukünftig „konsequente Abschiebungen“ von rechtskräftig abgelehnten Asylwerbern betrieben werden. Dafür seien „durchführbarere Maßnahmen“ erforderlich, präzisierte eine Sprecherin Faymann auf APA-Anfrage.
Grundsätzlich geht es Faymann um „Vermeidung von Illegalität sowie mehr Exekutive im Einsatz“, wie er betonte: „Ich sehe, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung steigt und verstehe die Ängste.“ Es gelte, einer zunehmenden Polarisierung in der Bevölkerung und der Verbreitung von Vorurteilen entgegenwirken, betonte der Kanzler.
Als die Ordnungshüter die beiden jungen Männer, einen 39- und 26-jährigen Tunesier aufhielten, wurden sie fündig. Beide trugen verdächtiges Einbruchswerkzeug bei sich, weshalb man die beiden Verdächtigen näher untersuchte.
Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Tunesier in einen Imbiss in der Bozner Pacinotti-Straße eingebrochen waren und dabei Zigaretten, Brote und Säfte erbeutet hatten.
Ausweisung
Aus diesem Grund wurden die beiden Männer sofort verhaftet und in das Gefängnis von Bozen gebracht.
Da gegen beide Tunesier bereits eine Verfügung zur Ausweisung ausgestellt war, ist davon auszugehen, dass die Täter sehr bald in ihre Heimatländer zurückgeführt werden.
Zum Unfall kam es gegen 03:50 Uhrauf der Pass-Thurn-Bundesstraße. Ein 45-jähriger Autofahrer aus Tirol kollidierte mit enem 36-jährigen Fußgänger.
Dabei erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus von St. Johann eingeliefert.
Unter Vorsitz von LH Günther Platter genehmigte der Forschungsbeirat des heuer gegründeten Tourismusforschungszentrum Tirol die ersten wissenschaftlichen Projekte. Die Universität Innsbruck startet heuer noch gemeinsam mit dem Management Center Innsbruck MCI eine Status Quo-Erfassung zur strategischen Ausrichtung von Familienunternehmen exemplarisch an fünf Pilotdestinationen. Geprüft wird auch, inwiefern alternative Finanzierungsformen wie Crowdfunding für diese Betriebe geeignet sind. Das dritte Projekt untersucht, wie Nicht-Familienmitglieder besser als dauerhafte MitarbeiterInnen in Familienbetriebe integriert werden können.
Das Tourismusforschungszentrum wird vom Land Tirol gemeinsam mit Wirtschaftskammer und den Tourismusverbänden finanziert. Träger sind das MCI sowie die Universität Innsbruck. Dem Forschungsbeirat gehören neben LH Platter der stellvertretende Vorsitzende Wissenschaftslandesrat Bernhard Tilg, Universität Innsbruck-Rektor Tilmann Märk, Hubert Siller, Leiter Department & Studiengänge des MCI, Franz Hörl als Wirtschaftskammer-Spartenobmann Tourismus und Freizeitwirtschaft sowie Franz Tschiderer vom Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis an.
LH Günther Platter sagt: „Das ist der Startschuss für eine praxisbezogene Forschungsarbeit, die sich zunächst den Tiroler Familienunternehmen im Tourismus widmet. Auf diese Weise werden wissenschaftlich abgesichert die Problemfelder der Betriebe analysiert. Gleichzeitig werden Lösungen für die Beseitigung von Defiziten erarbeitet. Aus dieser angewandten Forschung kann die Tiroler Tourismuswirtschaft direkten Nutzen ziehen.“
„HochschulprofessorInnen und deren DissertantInnen werden an Universität Innsbruck und MCI in einem interdisziplinären Dialog eine Kerngruppe für die Tourismusforschung in Tirol bilden. Die Forschungserkenntnisse werden auch unmittelbar in die Lehre Eingang finden und so nachhaltig über die Ausbildung den Tourismusmus-Standort Tirol stärken“, so LR Bernhard Tilg.
Gemäß Gesetz ist bei jedem Abschluss einer Fahrzeugversicherung ein Betrag von 10,50% der Prämie für Schäden aus Verkehrsunfällen bestimmt. Diese Geldsummen werden nach dem Bezahlen der entsprechenden Prämie von den Versicherungsgesellschaften an den Staat weitergeleitet, teilt Pius Leitner am Freitag mit.
Wie nun aus einer Antwort von Martha Stocker auf eine Anfrage des Abgeordneten Pius Leitner hervorgeht, überweist der Staat die eingezahlten Beträge wiederum ans Land Südtirol. Diese Quoten werden dann im Verwaltungshaushalt des Landes zu 100% als staatliche Zuwendung angeführt.
Landesrätin Stocker spezifiziert zudem, dass es sich um Beträge handelt, die an den Gesundheitsdienst für erbrachte Leistungen an Bürgern gehen, die in Verkehrsunfällen mit Kraft- und Wasserfahrzeugen verwickelt sind.
„Im Jahr 2015 erhielt das Südtiroler Sanitätswesen somit 18,7 Mio. Euro. Genaue Daten in Bezug auf die in Südtirol eingehobenen Summen kennt das Land aber nicht“, so Leitner.
Eine Diebin entriss einer 80-jährigen Frau ihre Handtasche, in der sich Bargeld und Dokumente befanden. Durch die Bilder einer Videoüberwachungskamera konnten die Beamten die mutmaßliche Diebin aufspüren, teilte die Bozner Quästur am Freitag mit.
In der Wohnung der beschuldigten H.J., fanden die Beamten bei einer Hausdurchsuchung Beweise. Die Ordnungshüter konnten dort die Kleidung sicherstellen, welche die mutmaßliche Diebin bei der Tat trug.
Der Freiheitliche Landesparteiobmann und Abgeordnete Walter Blaas hat sich kürzlich mittels einer Landtagsanfrage über die EU-Einmalzahlungen für Südtirols Milchbauern informiert.
Die Milchlandwirschaft befinde sich sowohl auf europäischer Ebene als auch in unserem Land in einer existentiellen Krise. Daraufhin habe die EU Gelmittel für eine sofortige Hilfe der Milchviehbetriebe bereitgestellt. Im Zuge dessen habe Italien mehr als 25 Millionen Euro von der EU zur Bekämpfung der gravierenden Situation der Milchbauern erhalten, so der Abgeordnete in einer Aussendung. Demnach erhalten Betriebe mit den EU-Einmalzahlungen 0,0027 Euro pro Kilogramm produzierter Milch. Als Berechnungsgrundlage diene die produzierte Milchmenge bis zum Quotenlimit aus dem Milchwirtschaftsjahr 2014/15.
Auf die Frage wie hoch der Anteil an den ca. 25 Millionen Euro der Sonderbeihilfen für die Milchbauern Italiens sei, der den Südtiroler Bauern zufällt, antwortete der zuständige Landesrat Schuler, dass der genaue Anteil an den erhaltenen Geldmitteln für Südtirols Milchbetriebe auf seine Anfrage hin nicht mitgeteilt worden sei. Da in Südtirol ca. 4% der gesamtstaatlich produzierten Milch produziert werde, dürften den Südtiroler Milchbauern ca. 1 Million Euro der 25 Millionen Euro zugeteilt werden. Das wiederum bedeute, dass jeder der ca. 5.000 Milchproduzenten rund 200 Euro erhalte, so Schuler.
Außerdem konnte der Abgeordnete Blaas aus der Antwort des Landesrates die Informationen entnehmen, dass die betroffenen Bauern auf die EU-Einmalzahlungen keine zusätzliche Steuer entrichten müssen.
Der durchschnittliche Auszahlungspreis der Südtiroler Milchhöfe machte im Jahr 2015 ab Erfassungsstelle bei natürlichen Inhaltsstoffen mit Qualitätszuschlägen und ohne Mehrwertsteuer 50,98 Cent pro Kilogramm Milch aus, so Schuler abschließend in seiner Antwort.
Einmalzahlungen mögen vielleicht wie ein heilendes Pflaster sein, seien aber keine zukunftsorientierten und gezielten Maßnahmen zur Bekämpfung der existentiellen Krise der Milchbauern. Was es schlichtweg brauche, sei finanzielle Unterstützung, die sich nicht auf einmalige Situationen beschränke, sondern fest etabliert sei, damit langfristig zum Erhalt der bedeutsamen Milchlandwirtschaft beigetragen werden könne, ist der Freiheitliche Abgeordnete überzeugt.
„Die Zukunft unserer Heimat liegt nicht beim italienischen Zentralstaat“, halten Blaas und Auer in einer Aussendung einleitend fest. „Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein verbrieftes Recht der Völker, die sich in einem fremden Nationalstaat befinden. Die Südtiroler Bevölkerung hatte nach dem ersten Weltkrieg nie die Möglichkeit über ihr weiteres Schicksal abzustimmen. Dieses Recht kann den Volksgruppen nicht weggenommen werden und bleibt bestehen. Die derzeit herrschende Autonomie ist nur eine Übergangslösung und nicht das Ende der Geschichte“, unterstreichen die Freiheitlichen.
„Die SVP hat in der jüngsten Vergangenheit immer wieder gezeigt, wie sehr sie die herrschenden Verhältnisse zementieren will, sich an Rom kettet und Gräben zur österreichischen Schutzmacht aufwirft“, betonen die Freiheitlichen und verweisen auf die jüngsten Aussagen von SVP-Obmann Achammer, der sich vor einem Bundespräsidenten Norbert Hofer „grauen“ würde.
„Die enge Bande zu Österreich ist die Garantie für das Fortbestehen der deutschen und ladinischen Minderheit und eine unverzichtbare Wurzel unserer Identität, die der Politik bewusst sein muss. Die anhaltende unkontrollierte Zuwanderung bietet den Ausgangspunkt die Südtirol-Autonomie, aufgebaut mit Österreichs Hilfe, aus den Angeln zu heben“, geben Walter Blaas und Simon Auer zu bedenken.
„Die gesamte Bevölkerung aller drei Volksgruppen unserer Heimat wird über den weiteren Weg entscheiden. Die Zukunft Südtirols liegt in den Händen der Südtiroler“, so Blaas und Auer abschließend mit einem klaren Bekenntnis zum Selbstbestimmungsrecht.
SVP-Bürgermeisterkandidat Christoph Baur hat heute mit seinem Team am Grieser Platz eine kurze Abschlusspressekonferenz gehalten: „Wir wollen die Stadt weiter bringen. Dafür müssen wir uns für neue Gedanken öffnen. Ich möchte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen allen Sprachgruppen, um konkret die Probleme der Landeshauptstadt anzugehen. Die Stadt braucht Sicherheit und Regierbarkeit. Ich lade alle demokratischen und autonomistischen Kräfte zu einem neuen politischen Stil und neuen Formen der Zusammenarbeit ein.“
„Wir besuchen als Team mit dem Fahrrad zum Abschluss heute noch einmal alle Stadtviertel – mit dem Versprechen, auch jene Gruppen und Gebiete unserer Stadt einzubeziehen, die möglicherweise in der Vergangenheit nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Unsere Kandidatenliste zeichnet sich durch Engagement, Sachverstand, Herz und durch eine besonders starke Vertretung von Jugend und Frauen aus.“
LH Kompatscher gegen Menschenrechte
Wenn Landeshauptmann Kompatscher das in Art. 1 der UN-Menschenrechtspakte verankerte Recht auf Selbstbestimmung als populistische Forderung abtue, stelle er sich damit gegen die Menschenrechte und auf die Seite der Nationalisten, die an den Grenzen des 1. Weltkrieges festhalten wollen.
Es seien genau diese nationalistischen Grundhaltungen, an denen Europa derzeit zu zerbrechen drohe. Wer die nationalstaatlichen Grenzen für unverrückbar halte und nicht bereit sei, neue Entwicklungen zuzulassen, gefährdee damit die Zukunft Europas.
Europas Völker müssen zusammenwachsen
Europa lasse sich nicht von oben herab verordnen, sondern müsse an der Basis zusammenwachsen. Diese Basis bilden jedoch nicht die Nationalstaaten, sondern die Völker und Regionen in Europa, die auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts frei und demokratisch darüber entscheiden können müssen, wie sie unter dem gemeinsamen Dach Europa leben wollen.
„Anstatt österreichische Politiker dafür zu kritisieren, dass sie in italienischen Medien für die Selbstbestimmung Süd-Tirols eintreten, sollte sich die SVP lieber die Frage stellen, warum sie nicht selbst diese Aufgabe übernimmt.“, so Knoll.
Noch nie sei es Müttern so gut gegangen, wie heute. Viele verdienen heutzutage ihr eigenes Geld, haben den Führerschein, sind wahlberechtigt und sozusagen „mit den Männern gleichgestellt“.
All dies mussten sich die Frauen in den letzten Jahrzehnten jedoch erst erkämpfen. Aber: „Die Mütter von heute haben Termine, ihre Kinder haben Termine. Die Mütter schauen ständig auf die Uhr und sollten längst schon woanders sein“, bedauert Michaela Rott Brunner, Bäuerin des Jahres 2016.
Die wahren Heldinnen
Viele Mütter hätten einen Job, der sich nur schwer mit Haushalt und Kindern verbinden lasse. Es brauche Kindertagesstätten, Sommerkindergärten und Omas, um der heutigen Mutterrolle gerecht zu werden. Und doch gebe es nichts Schöneres als Mutter zu sein, auch wenn es anstrengend ist, stellt Michaela Rott Brunner fest und betont: „Witwen, Mütter von kranken Kindern oder Kindern mit einer Beeinträchtigung, kranke Mütter, Mütter kinderreicher Familien, Mütter von verstorbenen Kindern, die sich nicht unterkriegen lassen, alleinerziehende Mütte: Ihr seid die wahren Heldinnen unserer Gesellschaft!“
Die Mütter einmal im Jahr als Heldinnen wahrzunehmen ist für die Südtiroler Bäuerinnenorganisation daher sehr wertvoll.
Am 13. April attackierte ein 23-jähriger Mann einen Stadtpolizisten in einem Lokal in Bozen. Der Quästor ein südtirolweites Aufenthaltsverbot über den albanischen Staatsbürger. Der Polizist wurde von einem Komplizen des 23-jährigen mit einem Glas im Gesicht und am Hals verletzt (UT24 berichtete).
Jugendlicher ausgeforscht
Die Ordnungskräfte konnten nun einen Tatverdächtigen ausmachen. Dabei handelt es sich um einen 18-jährigen Albaner. Dieser soll sich laut Augenzeugenberichten aktiv an der Auseinandersetzung beteiligt und den Stadtpolizisten anschließend mit einem Glas am Gesicht und am Hals verletzt.
Der junge Mann war bereits wegen Diebstahls polizeibekannt. Er wird angezeigt und wird sich für die Tat verantworten müssen.
Hasenhüttl hatte Ingolstadt in der vergangenen Saison erstmals in die höchste Spielklasse geführt und heuer frühzeitig den Klassenerhalt geschafft. Der Erfolgscoach hatte bei den „Schanzern“ noch einen Vertrag bis 2017, für seinen Wunschkandidaten machte Leipzig aber laut Ingolstadt „die höchste Ablöse, die bisher für einen Trainertransfer in Deutschland bezahlt wurde“, locker, nach dpa-Informationen 1,5 Millionen Euro. Dazu können später noch erfolgsabhängige Prämien kommen.
Vor zwei Jahren soll Bayer Leverkusen angeblich 1,5 Millionen Euro für seinen Trainer Roger Schmidt an Red Bull Salzburg überwiesen haben. Dies galt im deutschen Fußball bisher als Rekordsumme, die nun durch den Hasenhüttl-Wechsel übertroffen wird.
Eigentlich hatten die Leipziger die Personalie erst nach der definitiven Entscheidung über den Aufstieg bekanntgeben wollen, doch offenbar waren die Ingolstädter drauf und dran, ihnen zuvorzukommen. Deshalb gab der Red-Bull-Club schon vor dem wohl entscheidenden Heimspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC das Engagement von Hasenhüttl bekannt, der die „absolute 1a-Lösung“ für die nächste Saison gewesen sei, wie der Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff am Freitag betonte.
„Da feststeht, dass er so oder so unser Trainer wird, gab es keinen Grund mehr, damit hinter dem Berg zu halten“, sagte Ralf Rangnick bei einer Pressekonferenz, nachdem er und Vorstand Mintzlaff sich zuvor noch getrieben und missmutig statt heiter und gelöst gegeben hatten. Mintzlaff sprach von „zähen und mühsamen Verhandlungen“ mit dem FCI.
Rangnick lobte Hasenhüttl, der Ingolstadt vom letzten Platz der 2. Liga im Oktober 2013 zum Aufstieg und sicheren Klassenverbleib in der Bundesliga geführt hatte. „Viel mehr geht nicht“, sagte der Noch-Trainer, der künftig nur noch Sportdirektor sein wird. Hasenhüttl ist der siebente Trainer bei RB seit der Vereinsgründung 2009.
Die Ingolstädter hätten den Coach, der einen Vertrag bis 2017 hatte, gern behalten, besaßen offenbar aber deutlich schlechtere Karten. „Wir sind ein Verein, der Spielern und offensichtlich jetzt auch Trainern als Sprungbrett dienen kann“, sagte Sportdirektor Thomas Linke vor dem Spiel gegen den Tabellenführer FC Bayern mit einem Grinsen.
Hasenhüttl hinterlässt bei den Schanzern ein großes Erbe. „Ich habe hier viel aufgebaut und hoffe, dass die Erfolgsstory weitergeht“, sagte der Grazer. „Jeder hat gemerkt, wie wohl ich mich gefühlt habe.“
Künftig vertrauen die Oberbayern auf Kauczinski, einer „Lösung, von der wir absolut überzeugt sind“, wie Linke über den „absoluten Fußballfachmann“ sagte. „Wir wollten sicherstellen, dass es kein Vakuum gibt und dass es ein Trainer ist, der unsere Philosophie mitlebt.“ 2015 erst hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den gebürtigen Gelsenkirchener als Trainer des Jahres ausgezeichnet, nachdem dieser den KSC von der dritten Liga in die Aufstiegs-Relegation zur Bundesliga geführt hatte. Dort scheiterte er knapp am Hamburger SV.
Kauczinski habe „den Trainerberuf mit all seinen Facetten von der Pike auf erlernt und jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von jungen Talenten sowie der Führung von gestandenen Spielerpersönlichkeiten“, sagte FCI-Geschäftsführer Harald Gärtner. „Alle Gremien“ seien von dem gebürtigen Gelsenkirchener, der auch als Trainerkandidat beim FC Augsburg gehandelt worden war, überzeugt.
„Wir gehen davon aus, dass es ein Streit zwischen Rockern war“, sagte Nadia Niesen, Sprecherin der Frankfurter Staatsanwaltschaft, am Freitag. Nach dem oder den Schützen und nach der Tatwaffe werde gesucht. Es habe mehrere Durchsuchungen gegeben, sagte Niesen. Einzelheiten nannte sie nicht. Schon vor knapp zwei Jahren hatten sich Hells-Angels-Mitgliedern am Rand des Frankfurter Bahnhofsviertels beschossen.
Dieses Mal spielte sich das Geschehen in der Nähe der Hauptwache in der City ab. Ein oder mehrere Täter hatten am Donnerstagnachmittag auf einem belebten Platz mit Bars und Cafes auf einen weißen Geländewagen geschossen, aus dem zwei 20 und 41 Jahre alte Männer stiegen. Mehrere Schüsse trafen die Windschutzscheibe. Das Auto mit Gelnhausener Kennzeichen habe auch die Zahlenkombination 18 aufgewiesen, ein Hinweis auf Hells Angels – der erste und der achte Buchstabe im Alphabet.
Der oder die Schützen müssen vor dem vollbesetzten Cafe auf den Wagen gewartet haben: Ein Schütze sei direkt auf das Auto zugegangen und habe geschossen, sagte Niesen. Einer der Männer, die aus dem Auto stiegen, habe ebenfalls eine Waffe gezogen, sei aber nicht mehr zum Schuss gekommen, sondern vorher getroffen zusammengebrochen. Die Waffe ließ er fallen, sie wurde sichergestellt.
Die beiden 20 und 41 Jahre alten Männer, die von Schüssen getroffen wurden, wurden ins Krankenhaus gebracht. Einer der beiden sei operiert worden, sagte Niesen. Beide Männer seien außer Lebensgefahr.
Die Ermittler konzentrierten sich bei der Tätersuche zunächst auf einen schwarzen Kombi und ein sichergestelltes Motorrad. Sie könnten als Fluchtfahrzeuge gedient haben. Einen terroristischen Anschlag schlossen die Ermittler aus.
Im Sommer 2014 waren unter Hells-Angels-Mitgliedern am Rand des Frankfurter Bahnhofsviertels Schüsse gefallen. Die Kontrahenten gehörten zwei verschiedenen Gruppen der Rocker an. Vier Menschen waren damals verletzt worden. Der Vorwurf des versuchten Totschlags wurde später fallengelassen. Der mutmaßliche Schütze könne sich auf Notwehr berufen, argumentierte die Staatsanwaltschaft. Hells Angels werden immer wieder mit Straftaten wie Schutzgelderpressung, Drogen-, Waffen- und Menschenhandel in Verbindung gebracht.
Facebook war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Software zur Gesichtserkennung erlaubt es, etwa im Internet systematisch nach Fotos bestimmter Personen zu suchen.
Der Kenianer zeigte sich bei seiner ersten justiziellen Befragung grundsätzlich „einvernahmefähig“, bemerkte die Gerichtssprecherin: „Er bestreitet aber nach wie vor, am Tatort gewesen zu sein.“ Der Verdächtige wird sowohl von Spuren als auch Augenzeugen des blutigen Geschehens belastet.
Offen ist, ob der Mann zum Tatzeitpunkt überhaupt zurechnungsfähig und damit schuldfähig war. Zur Klärung dieser Frage wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein psychiatrisches Gutachten eingeholt. Die U-Haft ist vorerst bis 20. Mai rechtswirksam. Offenbar geht die Justiz derzeit nicht davon aus, dass es der psychische Zustand des 21-Jährigen erforderlich macht, diesen im Otto-Wagner-Spital unterzubringen, wo psychotische Verdächtige vorläufig angehalten werden können.
Der 21-Jährige war – wie sich nach der Bluttat herausstellte – am Brunnenmarkt seit längerem als Unruhestifter bekannt bzw. gefürchtet. Er lebte dort als Obdachloser und soll mit gewalttätigem Verhalten und als Cannabis-Straßenverkäufer eine Art „Stammkunde“ der Polizeiinspektion Brunnengasse gewesen sein. Nach zwei gerichtlichen Verurteilungen – zuletzt kassierte er 2013 acht Monate teilbedingt, wovon er zwei Monate absitzen musste – attackierte er im Vorjahr erstmals einen Mann mit einer Eisenstange.
Dabei blieb es jedoch bei einer leichten Körperverletzung. „Zudem ist der Vorfall erst drei Wochen nach der Tat angezeigt worden“, berichtete die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Nina Bussek. Daher habe es aus damaliger Sicht keinen Grund gegeben, den 21-Jährigen in Haft zu nehmen: „Es hat sich um ein bezirksgerichtliches Delikt gehandelt.“
Laut Polizei wurde der 21-Jährige insgesamt 18 Mal angezeigt. Für die Justiz war er – mangels einer Meldeadresse – zuletzt nicht mehr greifbar und war daher zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben. Dass er keineswegs untergetaucht war, sondern am Brunnenmarkt regelmäßig als Störenfried in Erscheinung trat, sprach sich offenbar nicht bis zur Justiz durch. Bei Kontrollen durch die Polizei wurde ihm zwar mitgeteilt, dass er von der Staatsanwaltschaft gesucht wird. Das dürfte den 21-Jährigen aber nicht weiter interessiert haben. Behördliche Schriftstücke konnten ihm nicht zugestellt werden, da er keinen Wohnsitz hatte.
Für den freiheitlichen Volksanwalt Peter Fichtenbauer ist es „nicht nachvollziehbar“, dass der Mann zuletzt nicht mehr auffindbar gewesen sein soll, wie er am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Er kündigte ein amtswegiges Prüfverfahren ein. Die zuständigen Stellen hätten „zu lange zugesehen“, die Bluttat „hätte verhindert werden können“, meinte Fichtenbauer.
FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl kritisierte das Innenministerium, das es jahrelang verabsäumt hätte, den Mann nach Kenia abzuschieben. Der Mann war mit einem Touristenvisum als 14-Jähriger nach Österreich gekommen. Nach Ablauf des Visums kümmerte er sich nicht weiter um seinen Aufenthaltstitel. Trotz rechtskräftiger Verurteilungen blieb er im Land. Kickl kündigte eine parlamentarische Anfrage an den Innenminister an.
Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will unterdessen sämtliche negativ rechtskräftigen Asylbescheide – unabhängig vom Herkunftsland – Fall für Fall nochmals fremdenpolizeilich prüfen. Wie Sobotka-Sprecher Andreas Wallner am Freitag erläuterte, soll geklärt werden, woran in diesen Fällen jeweils die Abschiebung gescheitert ist. Außerdem hat Sobotka für kommenden Dienstag ein Treffen mit dem kenianischen Botschafter in Wien vereinbart, um Aussagen der diplomatischen Vertretung zu besprechen, die im Innenministerium Unmut erregt hatten. Im Unterschied zur Darstellung der Botschaft war laut Wallner die Abschiebung des Mordverdächtigen bisher nicht möglich, weil Kenia die dafür erforderlichen Papiere nicht ausgestellt hatte.
Geht es nach Bundeskanzler Werner Faymann (SPÖ), sollen Innenminister Sobotka und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) ein „Maßnahmenpaket gegen Gewalt“ ausarbeiten. Dafür sicherte Faymann seine „volle Unterstützung“ zu. Der Kanzler sprach sich für „durchführbarere Maßnahmen“ aus, um „konsequente Abschiebungen“ möglich zu machen.
Der Paragleitpilot wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Rosenheim geflogen. In Kärnten ist ebenfalls am Donnerstag ein Deutscher mit seinem Hängegleiter abgestürzt. Der 46-Jährige verletzte sich bei dem Unfall in Greifenburg (Bezirk Spittal). Laut Polizei war der Mann im Rahmen der „Deutschen Open für Hängegleiter“ auf der Emberger Alm gestartet. Beim Anflug zum Landeplatz wurde er von einer Windböe erfasst und stürzte aus etwa zehn Metern Höhe zu Boden.
Nach Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Am Fluggerät entstand Totalschaden.
apa
Die Studie mache deutlich, dass Feinstaub in Großstädten weltweit „so viel und so schnell wie möglich reduziert werden muss“, sagte Mitautor Neil Thomas von der britischen Universität Birmingham.
Das Ergebnis: Bei einer um zehn Mikrogramm erhöhten Konzentration von Feinstaub pro Kubikmeter Luft erhöhte sich das Risiko, an Krebs im oberen Verdauungstrakt zu sterben, um 42 Prozent. Das Sterberisiko durch Krebs an der Leber, Pankreas oder Gallenblase stieg demnach um 35 Prozent. Bei Frauen nahm das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, sogar um 80 Prozent zu, wie die Forscher berichteten. Die Experten aus Hongkong und Großbritannien veröffentlichten ihre Studie im Journal „Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention“.
Als Feinstaub werden winzige Partikel bezeichnet, die eine gewisse Zeit in der Luft schweben. Ursprung der Schadstoff-Teilchen können etwa Dieselruß, Reifenabrieb oder Abgase von Industrie-, Kraftwerks- oder Heizungsanlagen sein. Je nach Größe und Eindringtiefe der Teilchen sind die gesundheitlichen Wirkungen von Feinstaub nach Angaben des Umweltbundesamtes verschieden. Als besonders gefährlich gelten ultrafeine Teilchen mit weniger als 2,5 Mikrometern Durchmesser (PM2,5), die sich tief in den Bronchien und Lungenbläschen festsetzen oder sogar ins Blut übergehen können.
Die neue Oberstufe soll an allen mindestens dreijährigen Oberstufenformen ab der 10. Schulstufe (6. Klasse AHS bzw. zweiter Jahrgang oder zweite Klasse an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen/BMHS, land- und forstwirtschaftlichen Schulen sowie Bundesanstalten für Kindergarten- bzw. Sozialpädagogik) umgesetzt werden. Der Lernstoff wird dabei in je ein Semester umfassende Module unterteilt.
Bei einer negativen Note in einem Fach muss nicht die ganze Klasse wiederholt, sondern nur das jeweilige Modul positiv abgeschlossen werden. Mit bis zu zwei „Nicht genügend“ in den Semesterzeugnissen kann man aufsteigen (bei Beschluss der Klassenkonferenz sogar einmal im Verlauf der Oberstufe mit drei „Nicht genügend“), bis zur Matura müssen aber alle Module nachgeholt sein. Dies erfolgt durch die positive Ablegung einer sogenannten „Semesterprüfung“.
An rund 200 Schulen bzw. einem Viertel der Standorte (darunter fast ausschließlich BHS) wird das Modell bereits erprobt. 2017/18 sollte es ursprünglich flächendeckend umgesetzt sein – mit der geplanten Gesetzesnovelle dürfen Gymnasien und BMS den Start aber um bis zu zwei Jahre verschieben.
Bis zum Inkrafttreten müssten aber einige Punkte überdacht werden, so AHS-Lehrergewerkschaft und -Direktoren in ihren jeweiligen Stellungnahmen. Dazu zählt etwa die Semestergliederung in der Maturaklasse: Das zweite Semester der Abschlussklasse sei wegen der Reifeprüfung teilweise extrem kurz, so die Lehrervertreter: „In einem Zwei-Stunden-Fach stehen u.U. nur zwölf beurteilungsrelevante Unterrichtseinheiten zur Verfügung.“ Die Vermittlung von Lerninhalten und die Leistungsfeststellung in dieser kurzen Zeit setze Schüler und Lehrer unter Druck. Lösungsansatz: „Die letzte Schulstufe wird als ein Semester bzw. ein Beurteilungszeitraum geführt“, so Lehrer und Direktoren unisono. „Völlig zu Recht wurden diesbezügliche Regelungen auch schon für die derzeitigen Abschlussklassen eingeführt.“
Ebenfalls problematisch sehen Lehrer und Direktoren die Möglichkeit, dass Schüler im Extremfall wegen der im Gesetz eingeräumten Wiederholungsmöglichkeiten in einem bestimmten Gegenstand in der gesamten Oberstufe keine einzige positive Leistung erbringen und trotzdem in die Maturaklasse aufsteigen können. „In diesem Fall erscheint ein Scheitern vor der Matura vorprogrammiert“, so die Lehrervertreter. Nötig sei daher eine Modifikation der Bestimmung: Die Fünfer sollen sich nicht in einem einzelnen Gegenstand ansammeln dürfen.
Elternvertreter und die BMHS-Lehrergewerkschaft wiederum fordern die Möglichkeit, die Einführung der NOST auch an BHS verschieben zu können. Das Feedback aus den Schulen zeige, „dass es bei der schulversuchsmäßigen Umsetzung auch im BHS-Bereich massiven ‚Entwicklungsbedarf‘ gibt“, heißt es in der Gewerkschaftsstellungnahme.
Nur Detailkritik gibt es in den Stellungnahmen an den im ersten Schulrechtspaket enthaltenen, im Vorfeld teilweise hitzig diskutieren Plänen, die etwa die Abschaffung des Sitzenbleibens sowie die Wahlmöglichkeit zwischen alternativer Leistungsbeurteilung und Ziffernnoten in den ersten drei Schulstufen oder „Sprachstartgruppen“ für Schüler mit mangelnden Deutschkenntnissen betreffen.
Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr in der Mutterbergstraße. Ein 32-jähriger deutscher Staatsbürger kam im Bereich eines Parkplatzes mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab, wodurch das Heck des Pkw ausbrach. Das Auto wurde auf die gegenüberliegende Seite geschleudert und prallte gegen einen geparkten Pkw.
Beide Fahrzeuge auf Dach gekippt
Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge auf das Dach gekippt und ein weiterer daneben geparkter Pkw beschädigt.
Der Pkw-Lenker und sein Beifahrer, ein 38-jähriger deutscher Staatsbürger, wurden mit schweren Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. „In den beiden geparkten Fahrzeugen befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine Personen“, teilt die Polizei mit.
Heinz Christian Strache forderte gegenüber der italienischen Tageszeitung La Repubblica, dass die Bevölkerung Südtirols mittels des Selbstbestimmungsrechts frei über ihre Zukunft entscheiden können sollte und sprach sich für die Wiedervereinigung Tirols aus (UT24 berichtete).
Daraufhin meldete sich Reinhold Messner, Extrembergsteiger und ehemaliger EU-Abgeordneter der Grünen zu Wort. Messner erklärte gegenüber ANSA, dass die Freiheitlichen Populisten seien, die den Frieden in Südtirol zerstören würden. „Wer heute so etwas vorschlägt, hat nichts aus 1937 und der Tragödie Südtirols gelernt.“
Strache: „Sollte gerade in der EU kein Problem darstellen“
Strache konterte gegen Messner und teilte mit: „Das Selbstbestimmungsrecht gilt für alle Völker und hat auch für die Südtiroler zu gelten. Bezeichnend argumentiert daher Herr Messner. Er spricht sicher nicht für die Mehrheit der Südtiroler und Tiroler, welche sich eine zukünftige Landeseinheit (mittels eines Selbstbestimmungsrechts) wünschen, welches man ihnen bis heute verwehrt und welches gerade in der EU heute kein Problem darstellen sollte.“
Das geheimnisumwitterte Gespräch der beiden mächtigen roten Länderchefs habe in Eisenstadt stattgefunden und etwa zweieinhalb Stunden gedauert. Es sei „gut und freundschaftlich“ verlaufen, sagte Niessls Sprecher Herbert Oschep danach zur APA. Beide Landesspitzen seien sich einig, dass man nun in erster Linie die in der SPÖ entstandenen Gräben zuschütten und Positionen erarbeiten müsse, die von allen vertreten werden. Dabei gehe es um die klassischen Themen – beispielsweise Arbeitsmarkt, Wirtschaft, Soziales und die Haltung zur FPÖ. Inhalte und Positionen zu erarbeiten gehe „nicht von heute auf morgen“. Wichtig sei, geschlossen aufzutreten, denn nur so könne die SPÖ wieder Wahlen gewinnen. Zu personellen Fragen hielt man sich bedeckt. Auch zu einer möglichen Vorverlegung des SPÖ-Bundesparteitages gab es keinen Kommentar.
Inwieweit sich die Länder von einem Verbleib des Kanzlers überzeugen lassen, bleibt abzuwarten. Klar für eine Ablöse Faymanns hat sich bisher bloß Salzburg positioniert. Die Steiermark tendiert dem Vernehmen nach dazu, Faymann durch ÖBB-Chef Christian Kern zu ersetzen, Vorarlberg hätte am liebsten einen neuen Kandidaten, der mit einem dezidierten Linkskurs in eine Neuwahl zieht. Kärnten scheint noch unschlüssig, bei den anderen Ländern zeichnete sich zuletzt eine leichte Tendenz für einen Verbleib des Parteichefs ab, auch wenn sich manche Wiener Repräsentanten Medien-Manager Gerhard Zeiler an der Spitze wünschen. Entschieden wird wohl erst übers Wochenende.
Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil hofft in der Vorstandssitzung seiner Partei am Montag auf „klare Worte“. Er erwarte sich, dass die in den Medien der vergangenen Tage kommunizierten Meinungen auch im Vorstand deutlich ausgesprochen werden. Anschließend könnten Entscheidungen getroffen werden, sagte Doskozil am Freitag in Bregenz auf Journalisten-Anfrage.
Über die Medien zu diskutieren sei nicht fair, „diese Art des Meinungsaustauschs und der Konfliktführung gefällt mir nicht“, kritisierte der Verteidigungsminister Parteikollegen, ohne konkret zu werden. Konsequenterweise gab Doskozil zur Vorstandssitzung am Montag keinen Kommentar ab: „Ich bin nicht angetreten, um irgendjemandem irgendetwas auszurichten oder um Öl ins Feuer zu gießen“.
Niederösterreichs SPÖ-Landesparteichef Matthias Stadler hat sich am Freitag klar hinter den Bundesparteivorsitzenden Werner Faymann gestellt. Im Ö1-„Mittagsjournal“ wandte er sich auch vehement gegen eine Vorverlegung des für November angesetzten Parteitags. Dieser müsse ordentlich vorbereitet sein.
Keine klare Unterstützung für den Kanzler kommt bisher von den sozialdemokratischen Gewerkschaftern. Deren Vorsitzender Wolfgang Katzian meinte im „Standard“, die Debatte in der SPÖ sei allumfassend: „Sie schließt personelle Fragen ein.“ Sich künftig die Option Rot-Blau offen zu lassen, lehnte der in der Wiener Partei verankerte Katzian im Gegensatz zum Großteil der anderen Spitzengewerkschaftern ab.
Die roten Gewerkschafter wollen am Montagvormittag ihre Positionen abstecken. Thema im Präsidium und im Bundesvorstand der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter werden neben einer Analyse der Bundespräsidentenwahl „inhaltliche und personelle Veränderungen“ in der SPÖ sein, kündigte Bauarbeiter-Chef Josef Muchitsch am Freitag an.
Es gehe darum, zuerst die Inhalte abzustecken und dann über Personen zu reden, die diese glaubhaft vertreten können, meinte Muchitsch im Gespräch mit der APA. Der SPÖ-Sozialsprecher glaubt aber nicht, dass die FSG am Montagvormittag sich auf einen Namen für den SPÖ-Vorsitz festlegen wird. Man werde wohl eher nicht dem Parteivorstand und den Beratungen dort vorgreifen. Muchitsch hält es für wichtiger, dass die FSG die inhaltlichen Fragen klärt – die Haltung zur FPÖ sei „die größere Baustelle“, aber auch um die Linie in der Asylfrage soll es gehen.
Der Chef der Bauarbeitergewerkschaft kann sich einen Kompromiss in der Haltung zur FPÖ vorstellen. Demnach könnte jede politische Ebene ihr Verhältnis zu den Freiheitlichen selbst festlegen. Wenn eine Zusammenarbeit in einer Gemeinde oder einem Land sinnvoll sei, dann sollte das nicht mit Beschlüssen blockiert werden. Es solle nicht eine Doktrin auf einem Parteitag beschlossen oder aufrechterhalten werden, meinte Muchitsch.
Wenn allerdings auf Bundesebene die SPÖ Nein zu einer Koalition mit der FPÖ in ihrem gegenwärtigen Zustand sage, dann sei das zu akzeptieren. Er verstehe auch FSG-Vorsitzenden Wolfgang Katzian, wenn dieser eine Zusammenarbeit mit einer FPÖ ablehne, in der Burschenschaftern Nazi-Schriften nicht verboten würden. Hier gebe es auch keine unterschiedlichen Auffassungen innerhalb der FSG, betonte Muchitsch. Gleichzeitig verwies er aber neuerlich auf seine steirische Heimatgemeinde Leibnitz, wo ohne Zusammenarbeit mit der FPÖ nie ein SPÖ-Bürgermeister ins Amt gekommen wäre.
Bartoli übernimmt, wie auch in den vorherigen Jahren, neben der künstlerischen Leitung eine Hauptrolle in der szenischen Produktion. Neben Norman Reinhardt als Tony singt sie die Maria unter der musikalischen Leitung von Gustavo Dudamel. Der Broadway-erfahrene Philip Wm. McKinley inszeniert die moderne Version des „Romeo und Julia“-Stoffes in der Felsenreitschule. Die beiden Vorstellungen des Musicals am 13. und 15. sind seit langem ausverkauft.
Am Pfingstsamstag folgt die konzertante Aufführung der Oper „Giulietta e Romeo“ von Nicola Antonio Zingarelli. Die Rolle des Romeo singt darin Countertenor Franco Fagioli, an seiner Seite die schwedische Mezzosopranistin Ann Hallenberg als Giulietta. Aufgrund seines Erfolgs wurde das Werk mehrmals verändert, bei den Pfingstfestspielen bildet allerdings die Uraufführungsversion von 1796 die Grundlage der Partitur.
Um den selben Stoff choreografierte John Cranko sein Ballett „Romeo und Julia“, welches das Stuttgarter Ballett am Abend des 15. Mai im Großen Festspielhaus zeigt. James Tuggle leitet dabei das Mozarteumorchester Salzburg zur Musik Prokofjews. Dem voraus geht die Kammermusik-Matinee mit Geigerin Julia Fischer und Milana Chernyavska, bei der die beiden Werke von Dvorak, Bohuslav Martinu und Peter Tschaikowski interpretieren und sich in Pablo de Sarasates „Caprice sur Romeo et Juliette“ dem Festspielmotto nähern.
Das Festival endet mit einer Premiere beim Galakonzert. Erstmals werden die Wiener Symphoniker unter der Leitung von Marco Armiliato zu Gast bei den Pfingstfestspielen sein. Juan Diego Florez und Angela Gheorghiu singen gemeinsam Arien aus Gounods „Romeo et Juliette“, und auch das Orchester spielt Werke, die allesamt vom eben genanntem Liebespaar inspiriert sind.
Die Eintrittskarten für die verschiedenen Konzerte kosten zwischen 18 und 290 Euro, Karten für das Ballett gibt es zwischen 80 und 200 Euro. Die beiden Musicalvorstellungen sind komplett ausverkauft.
Das Selbstbestimmungsrecht sei ein Völkerrecht, das Südtirol habe. „Aber es berechtigt uns nicht, einen eigenen Staat zu gründen“, so der Landeshauptmann zur TT. Mit seinen Ausführungen empfehle sich Strache nicht für höhere Weihen. „Ihm fehlen der europäische Blick und die Perspektive für Europa“, fügte er hinzu.
Kompatscher äußerte ebenfalls ein Unbehagen über einen möglichen blauen Bundespräsidenten in Österreich. „Wir werden auch mit einem Bundespräsidenten Norbert Hofer eine normale Gesprächsbasis haben. Ich sorge mich aber darüber, dass mit ihm gewisse Wertvorstellungen des FPÖ-Parteiprogramms, die ich keinesfalls teile, in die Hofburg einziehen würden“, erklärte der Landeshauptmann.
Tirols Landeshauptmannstellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) forderte indes von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) Verantwortung zu übernehmen und die Wogen zu glätten. „Tirol ist eng zusammengewachsen, Straches Ideen würden es wieder auseinanderreißen“, so Felipe.
Tirols FPÖ-Landesparteiobmann Markus Abwerzger stellte sich hinter die Forderung von Strache. „Kompatscher hat sich im September 2013 in einem Interview für eine Wiedervereinigung Südtirols mit dem Bundesland Tirol ausgesprochen, nun scheint er aber seine damalige Position vergessen zu haben, was ja typisch für die Funktionäre der SVP ist“, meinte Abwerzger. Ob Freistaat oder Beitritt zur Republik Österreich hätten die Südtiroler selbst zu entscheiden, fügte er hinzu.
Kritik am Vorschlag Straches kam auch vom Trentiner Landeshauptmann Ugo Rossi. „Straches Vorschlag droht Wunden zu öffnen, die nie ganz vernarbt sind“, sagte Rossi der römischen Tageszeitung „La Repubblica“. „Seit 1948 brauchen wir uns nicht mehr in Nationalstaaten abzuschotten. Wir können die Wirtschaft grenzüberschreitend entwickeln“, sagte Rossi. Der Ruf nach Grenzen sei anachronistisch. Trotz der Ängste, die durch die Flüchtlingskrise geweckt worden seien, dürfe man „keine Schritte zurück machen“, betonte der italienische Politiker.
„Hier gibt es vermischte Volksgruppen, die in Harmonie leben“, sagte Rossi, der auf die kulturelle Vielfalt und die lange Tradition des Islam in Österreich verwies. „Man sollte Strache daran erinnern“, betonte der Landeshauptmann, der Mitglied des Dreierlandtags der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist.
Österreichs Pläne zu Grenzkontrollen seien laut Rossi in dieser Phase nur „Wahlpropaganda“. „Doch Italien muss seinen Teil leisten. Die Zeiten für die Prüfung der Asylanträge müssen reduziert werden“, sagte Rossi. Auch Abschiebungen von Migranten sollten wenn notwendig beschleunigt werden.
Strache hatte sich gegenüber der italienischen Tageszeitung „La Repubblica“ für eine Wiedervereinigung Tirols ausgesprochen. „Ich will die bestehenden Wunden heilen und Tirol die Möglichkeit geben, sich wieder zu vereinen“, hatte der FPÖ-Chef gesagt. Südtirol solle die Möglichkeit zur Selbstbestimmung gegeben werden. Es solle frei über seine Zukunft entscheiden können.
Der 37-Jährige übte mit einem Freund im Klettergarten hinter dem Weichtalhaus im Höllental. Der Mann hatte die Wand schon einmal durchstiegen, beim zweiten Versuch kam es zum Absturz. Ein zufällig anwesender Bergretter der Ortsstelle Reichenau verständigte den Notarzt. Die Unfallursache ist bisher unbekannt. Laut Bergrettung war der Kletterer ordnungsgemäß ausgerüstet.
Konkret meint der Rapper im APA-Gespräch in erster Linie seine diversen Auseinandersetzungen mit der FPÖ, von Parteiobmann Heinz-Christian Strache (der ihn erfolgreich wegen Beleidigung klagte) abwärts. „Ich bin hinter den Kulissen sehr viel politisch schikaniert worden. Ich musste zum Verfassungsschutz wegen Volksverhetzung, wegen meiner Ansprache am Donauinselfest. Das sind Dinge, die einen Rapper sehr wütend machen, weil versucht wird, dich mundtot zu machen.“ Gelungen ist das keineswegs, greift Nazar doch auch auf „Irreversibel“ wieder etliche heikle Themen auf.
„Ich habe aus meiner Vergangenheit gelernt, nicht mehr aggressiv darauf zu reagieren, sondern es in meiner Musik umsetzen“, betont der Rapper, der bürgerlich auf den Namen Ardalan Afshar hört. „Ich wollte aber auch dieser Partei oder diesen Herrschaften nicht weiterhin eine Plattform bieten, indem ich sie erwähne oder Songs darüber mache. Also habe diese Wut einfach ins ganze Album verpackt.“ Das beginnt beim minimalistischen „Generation Darth Vader“, führt über das knackige „La Haine Kidz“ und mündet unter anderem in „Mein Viertel“, für das sich Nazar neuerlich Sido als Unterstützung am Mic holte.
Zeilen wie „Jeder kriegt, was er verdient“ oder „Wir sind die Generation mit Hass in der Brust“ werden dem Hörer entgegengeschleudert: Hier wird eine Dreiviertelstunde lang Gangsta-Rap par excellence vorgeführt, wobei in der zweiten Hälfte einige ruhigere Momente Zeit zum Durchatmen bieten. Wer mit Kraftausdrücken und Zuspitzungen nichts anfangen kann, ist aber eindeutig fehl am Platz. „Für den Hip-Hop-Hörer ist das nicht schwer zu verstehen“, erklärt Nazar seine direkten Texte über Gewalt und das Leben auf der Straße. „Für den Ö3-Hörer wiederum schon, für den wird es gewaltverherrlichend sein. Aber wenn der einen Kraftausdruck hört, ist für ihn wahrscheinlich sowieso die Welt schon vorbei. Für diese Menschen mache ich meine Musik aber nicht.“
Dennoch: Nicht zuletzt seit dem Vorgänger „Camouflage“ scheint Nazar am Zenit angekommen. Goldstatus, Spitze der Charts, ausverkaufte Konzerte – der Sprung aus dem Underground in den Mainstream wurde eindrucksvoll vollzogen. Ob und wie er ankommt, das ist für Nazar allerdings keine wichtige Frage. „Ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich mir in meiner Kunst und meinen Texten keine Grenzen setzen möchte. Wir machen Genremusik. Deutscher Hip-Hop ist leider immer noch eine Nische, obwohl er – bis auf Schlager – derzeit am erfolgreichsten ist. Dass es noch ein Nischending ist, liegt wahrscheinlich daran, dass es für viele Leute zu hart, zu extrem ist.“
Vielen dürfte es auch schwerfallen, den sehr reflektierten Mann, der sich über die Gesellschaft Gedanken macht, mit dem harten „Gangsta“ von Plattencover und Video in Einklang zu bringen. Wie weit geht das Image? „Ich wurde schon früh ins kalte Wasser geworfen“, erinnert sich Nazar an seine Anfänge vor rund acht Jahren. „Bei meinem ersten Album war ich ein sehr frustrierter Junge von der Straße, der sehr aggressiv war, aber trotzdem alles für seine Musik getan hat. Und dann liefen meine Videos auf MTV und ich war in Untersuchungshaft und habe dort mein erstes Video gesehen. Viel mit Image kreieren oder inszenieren war da nicht“, lacht der Rapper. Nicht zuletzt gibt er durch seine persönlichen Texte und eine teils entwaffnende Offenheit in Interviews viel von sich preis.
„Irreversibel“ ist aber vor allem eines: Ein wütender Blick auf eine in vielen Fragen zerrissene Gesellschaft – und dabei eher düsteres Stimmungsbild denn auf konkrete Personen gemünzte Anschuldigung. „Der Punkt ist: Diese Politik, die wir jetzt haben, wird seit Jahren in Europa betrieben. Ich brauche den Leuten nicht mehr erklären, wer Strache ist, was die FPÖ ist und wie ihre Politik funktioniert oder was ihre Hintergedanken sind. Das wissen die Leute mittlerweile schon selber. Das Traurige ist aber, dass die trotzdem immer mehr Anhänger bekommen.“ Anstatt plakativ etwas darüber zu sagen und wieder eine Strafe zu riskieren, wolle er lieber klarmachen, „dass es ein gefährliches Spiel ist, das gerade alle spielen“.
Damit spricht er u.a. die intensive Hetze gegen den Islam an. „Religion sollte eine sehr private Sache sein, die in den letzten Jahren eh schon von allen Seiten – sowohl von den Christen als auch Moslems – viel zu wichtig genommen wurde und viel zu sehr in die Öffentlichkeit gedrängt wurde.“ Andererseits seien Scherze über Religion, egal in welcher Form, „reine Provokation“, so Nazar. „Ich habe mit deiner Religion nichts zu tun. Ich muss sie nur zu 100 Prozent respektieren, weil wir in diesem Land leben und ich auch so erzogen wurde, dass ich jeden Menschen und jede Religion respektiere – egal, wie sie ist. Ich würde mir nie anmaßen, mich darüber lustig zu machen.“
Letztlich appelliert er an den gesunden Menschenverstand. „Ich hoffe, dass die Leute darüber nachdenken, was sie tun und was sie sagen.“ Das gelte auch für die Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten, wobei sich Nazar diesbezüglich relativ zurückhaltend zeigt. Man könne schwer abschätzen, was mit Österreich passieren würde, schaffe FPÖ-Kandidat Norbert Hofer den Einzug in die Hofburg. „Wenn man ehrlich ist, hat der Typ sich einfach perfekt präsentiert, was leider Gottes nicht allen anderen Kandidaten gelungen ist.“
Für ihn gehe es aber um eine andere Frage: „Die Mischung wird nicht gut, wenn Hofer Präsident und dann auch noch Strache Bundeskanzler wird. Dann hätte man das Gleiche, was jahrelang Rot-Schwarz vorgeworfen wurde: Dass dort viel zu viele gleiche Leute im Boot gesessen sind, die dann keine auf den Deckel bekommen haben, wenn etwas schief gelaufen ist.“ Er persönlich würde sich Alexander Van der Bellen als Präsident wünschen, „weil ich glaube, dass er uns auch international sehr gut vertreten könnte. Alles andere wird die Zeit zeigen. Man muss aber trotzdem alles – egal was passiert, denn Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie – akzeptieren. Das ist einfach so.“
(Das Gespräch führte Christoph Griessner/APA)
Die Freundin des Nigerianers beobachtete das Geschehen und schubste den 45-Jährigen zur Seite, worauf dieser in seiner Wohnung verschwand. Verständigte Cobra-Kräfte drangen in die unversperrte Wohnung ein und konnten den Beschuldigten festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Der Mann wurde zur Einvernahme ins Polizeianhaltezentrum gebracht. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der benützten Waffe um ein Luftdruckgewehr handelte.
Zum Unfall kam es auf der Lechtalbundesstraße gegen 15.50 Uhr. Ein 58-jähriger deutscher Staatsangehöriger wurde von einer Gruppe von drei Hirschkühen, die plötzlich auf die Fahrbahn sprangen, überrascht.
Kollision mit Tier
Es kam zur Kollision mit einem der Tiere, worauf der Motorradfahrer zu Sturz kam. Das Motorrad schlitterte anschließend gegen einen entgegenkommenden Pkw.
Der Motoradfahrer wurde mit einer Gehirnerschütterung und Prellungen in das BKH Reutte eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.
Nördlich der Stadt Fort McMurray waren am Freitag noch immer 17.000 Menschen eingeschlossen, berichtete der kanadische Fernsehsender CTV. Die Polizei begann, sie in Konvois von je 50 Fahrzeugen durch die brennende Stadt in den Süden zu lotsen. Andere wurden per Flugzeug gerettet.
Laut CTV waren bereits am späten Donnerstag (Ortszeit) rund 8.000 Beschäftigte der Ölfelder im Norden von Fort McMurray ausgeflogen worden. Für sie war der Nachschub von Lebensmitteln und Treibstoff durch die verheerenden Brände knapp geworden, schrieb die Zeitung „Globe and Mail“. Durch die Stadt führt nur eine Hauptstraße von Norden nach Süden, die 20 Kilometer lange Route 63, erläuterte CTV.
Unterdessen haben sich Tausende Menschen aus Fort McMurray in Notlager in der südlich gelegenen Stadt Edmonton gerettet. Dort haben Sport- und Geschäftszentren, Kirchen und Gemeinden sowie kanadische Ureinwohner Unterkünfte für die Vertriebenen bereitgestellt. Es könne Wochen oder Monate dauern, bis sie nach Fort McMurray zurückkehren könnten, sagte Albertas Regierungschefin Rachel Notley nach Angaben von CBC. Die Gegend sei nicht sicher.
Notley bezeichnete die Waldbrände als eine der größten Herausforderungen in der Geschichte der Provinz Alberta. Man kämpfe mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegen die Flammen. „Vor uns liegt ein sehr schwerer Weg und große Ungewissheit, solange die Feuer weiter brennen“, sagte die kanadische Politikerin.
Mehr als 1.000 Feuerwehrkräfte waren Behördenangaben zufolge im Einsatz. Aus anderen Provinzen sollte Verstärkung anrücken, wie Medien berichteten. Albertas Regierung hatte Donnerstag früh mitgeteilt, sieben von 49 Bränden seien außer Kontrolle. Neben den Hundertschaften der Feuerwehr wurden demnach auch 145 Hubschrauber und 22 Löschflugzeuge genutzt.
Experten schätzten die Schäden der Katastrophe auf umgerechnet bis zu sechs Milliarden Euro, wie Medien berichteten. Viele Kanadier wollen die Betroffenen der Waldbrände unterstützen. Beim Roten Kreuz Kanada gingen Spenden in Höhe von 7,5 Millionen Euro ein, wie die Organisation bei Twitter mitteilte.

